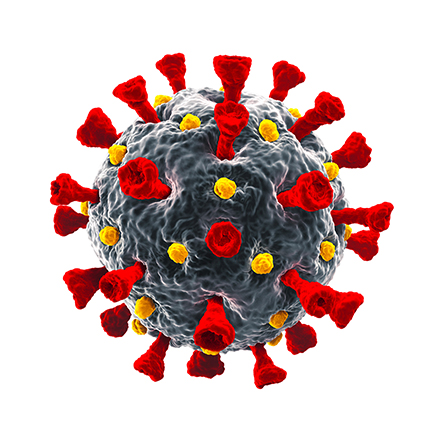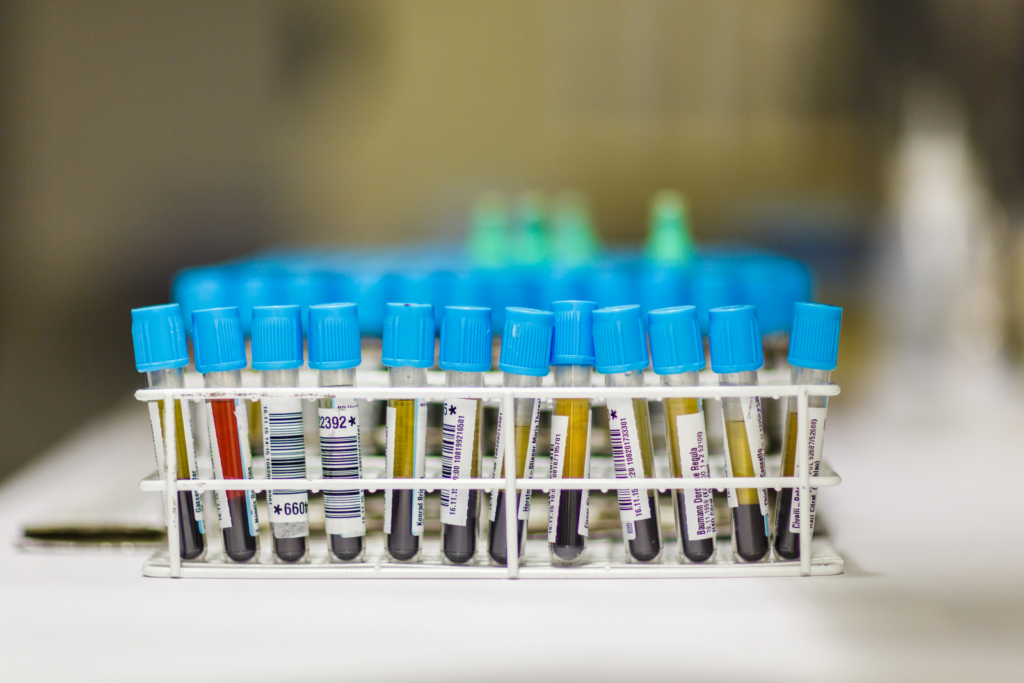Dominique Braun ist Oberarzt in der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene und forscht seit dem Auftreten von SARS-CoV-2 zu Medikamenten gegen COVID-19. Im Interview erläutert er die Antikörpertherapie und warum es trotz Impfung noch neue Medikamente braucht.
Herr Braun, die Entwicklung einer Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 gelang glücklicherweise sehr schnell. Wo stehen wir bei Medikamenten, mit denen gezielt COVID-19 behandelt werden kann, bevor es zu einem schweren Krankheitsverlauf kommt?
Das USZ war an vielversprechenden Studien dazu beteiligt. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Medikamenten, deren Wirksamkeit aber noch nicht bahnbrechend ist. Eine dieser therapeutischen Optionen ist die Therapie mit monoklonalen Antikörpern. Wir können also Teilerfolge verbuchen, der grosse Durchbruch ist noch nicht da. Zudem stellt uns die Omikron-Variante wieder vor neue Herausforderungen, da zum Beispiel einige dieser monoklonalen Antikörper nicht mehr wirksam sind.
Die Impfung wirkt sehr gut gegen eine schwere COVID-19-Erkrankung. Warum braucht es dennoch Medikamente?
Die Impfung bietet einen hohen Schutz vor einem schweren Verlauf, das stimmt. Für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, wegen einer Immunsuppression nicht oder weniger gut auf eine Impfung ansprechen oder wegen anderer Vorerkrankungen ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf tragen, sind solche Medikamente aber extrem wichtig. Und es gibt ja auch Personen mit Risikofaktoren, die sich aus anderen Gründen nicht impfen lassen wollen.
Wie wirken diese Medikamente und die Antikörpertherapie?
Ziel dieser Medikamente ist es, einen schweren Verlauf zu verhindern und damit Komplikationen, die zu einem Spitalaufenthalt führen, zu lange dauernder Krankheit und bei einigen Patientinnen und Patienten auch zum Tod. Antivirale Medikamente verhindern die Vermehrung der Viren und halten so die Krankheit in Schach. Antikörper blockieren die Spike-Proteine – die Viren können dann nicht mehr in die Zellen eindringen und werden so neutralisiert. Diese Therapie wird eingesetzt bei Patienten, die selber keine natürlichen Antikörper bilden können oder sich in der Frühphase der Infektion befinden, in der die Antikörper noch nicht ausreichend gebildet wurden.
Das heisst, diese Medikamente müssen sehr früh eingesetzt werden?
Ja, die Antikörpertherapien wirken nur, wenn sie innerhalb von fünf Tagen nach Beginn der Symptome angewendet werden. Ausnahme sind Patienten mit einem geschwächten Immunsystem, wo wir die Therapie auch bei längerer Symptomdauer einsetzen, abhängig davon, ob bereits Antikörper im Blut nachweisbar sind. Das stellt gerade bei der Antikörpertherapie hohe Anforderungen an den ganzen Patientenprozess, von der Abklärung bis zur Logistik.
Wie läuft der Prozess denn im Einzelnen ab, bis ein Patient die möglicherweise lebensrettenden Antikörper erhält? Wo liegen die Schwierigkeiten?
Das beschränkte Zeitfenster und die Kapazitäten sind das zentrale Problem. Nehmen wir Herrn X. als Beispiel. Er geht erst zu seiner Ärztin, wenn er COVID-Symptome hat, eventuell wird erst dann ein Test gemacht. Seine Ärztin muss dann schnell erkennen, dass Herr X. ein erhöhtes Risiko hat, mit ihm die Therapie besprechen und ihn bei uns anmelden. Wir suchen nach einem Termin für Herrn X. in der Tagesklinik, denn die Antikörper müssen intravenös verabreicht werden. Die Antikörper müssen bestellt werden bei der Kantonsapotheke, die diese zum Termin hin herstellt. Herr X. muss unter Isolation möglicherweise von weit her ins USZ reisen. In dem Zeitfenster von häufig nur ein bis zwei Tagen muss also ziemlich viel passieren, damit Herr X. mit Antikörpern behandelt werden kann.
Wie steht es mit Angebot und Nachfrage?
Die Nachfrage ist sehr fluktuierend, was die Planung schwierig macht. Dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte diese Therapie kennen und ihre gefährdeten Patientinnen und Patienten zu uns schicken, ist eine erfreuliche Entwicklung. Bedauerlich ist, dass etwa ein Drittel dieser Risikopatienten sich aus medizinischer Sicht durchaus hätte impfen lassen können. Häufig gab es keinen einzigen Termin mehr, obwohl die Mitarbeitenden der Tagesklinik und der Infektiologie den Betrieb bis zum maximal Machbaren ausgebaut haben und einen enormen Einsatz leisten. Bis vor Kurzen war das USZ das einzige Spital, das einen Leistungsauftrag für die Antikörpertherapie hatte; vor ein paar Wochen kam auch das Kantonsspital Winterthur dazu und seit Kurzem nun auch andere Spitäler im Kanton Zürich.
Wagen Sie einen Blick in die Zukunft?
Die Antikörper waren bei den bisherigen Varianten von SARS-CoV-2 hilfreich, die Therapie ist jedoch logistisch aufwändig und vieles unplanbar. Ihre Wirkung hält auch nur einige Wochen an, und immunsupprimierte Patientinnen und Patienten bauen dadurch keine eigene Abwehr auf. Könnten die Antikörper in Zukunft beim Hausarzt in den Muskel oder in das Unterhautfett gespritzt werden, wäre das für die Patienten, die darauf angewiesen sind, deutlich einfacher. Und natürlich hoffen wir, dass sich auf bei der Entwicklung der antiviralen Medikamente bald ein Durchbruch abzeichnet.
Was macht Ihnen gerade am meisten Sorgen?
Seit Kurzem wissen wir, dass hospitalisierte, schwer kranke Patienten mit der Omikron-Variante nur schlecht oder gar nicht auf die monoklonalen Antikörper ansprechen. Für diese steigende Zahl von Patienten haben wir nun kein spezifisches Medikament mehr, bis hoffentlich bald ein neues entwickelt ist. Im ambulanten Bereich haben wir immerhin noch einen monoklonalen Antikörper, der gegen Omikron wirksam ist. Sollte die Wirksamkeit dieser Therapie auch beim Einsatz für die noch nicht schwer kranken Patienten nachlassen, wären unsere Mittel noch weiter beschränkt. Umso wichtiger ist es, dass wir die Übertragung eindämmen, indem wir uns impfen oder nun boostern lassen. Mit jeder verhinderten Übertragung, verhindern wir potenziell auch einen schweren Verlauf. Damit entlasten wir nicht nur die Spitäler, sondern verhindern auch viel Leid.